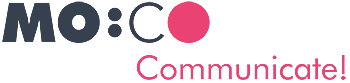Heute bin ich im Gespräch mit Prof. Dr. Andreas Wirsching, Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin und Hauptherausgeber der Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland (AAPD). Er formuliert Gefahren von Corona auf unser demokratisches Zusammenleben. Einerseits gibt es viel Solidarität, andererseits spalten Ängste, Vertrauensverlust und Wut unsere Gesellschaft. Wirsching fordert ein Ende der Politik der Verordnungen und fordert die Parteien auf, sich stärker einzubringen. Ganz grundsätzlich wünscht er sich die Zukunft unserer Demokratie in einer partizipatorisch-kommunikativen Form.
MO: Wir leben in einer herausfordernden Zeit. In der Corona-Pandemie entscheiden Politiker vielfach auf Basis von Rechtsverordnungen. Auf Basis des Infektionsschutzgesetzes werden Freiheitsrechte eingeschränkt. Vielerorts herrschen Angst und Unsicherheit. Welche Auswirkung hat Corona auf unser gesellschaftliches Zusammenleben?
Andreas Wirsching: Die Corona-Pandemie ist eine Zäsur, auch in demokratiegeschichtlicher Hinsicht. Sie ist aber auch ein Katalysator, ein Beschleuniger von bereits zuvor existenten Prozessen. Es ist eine schwierige Gemengelage. Die Probleme durch Corona führen zu einer Steigerung verschwörungspolitischen Denkens. Propaganda gegen Regierungspolitiker sind alltäglicher geworden. Das sind Dinge, die sehr scharf wirken, aber wir haben solche propagandistischen Spitzen auch vorher erlebt. Der Rechtsruck ist älteren Datums: Seit 2015 gab es ihn in allen westlichen Demokratien und in allen Teilen der Welt. Das liegt teilweise an den Abgehängten durch die Globalisierung. Teilweise. Aber sehr viel beunruhigender ist es, wenn der Extremismus die Mittelschicht erreicht. Da wirkt jetzt die gegenwärtige Pandemiekrise als extremer Spalter der Gesellschaft. Die Folgen der Maßnahmen gegen die Pandemie wirken sich sehr unterschiedlich aus. Und das ist der Nährboden für starke Ressentiments, die daraus erwachsen können. Davon profitieren insbesondere die sogenannten Querdenker, die Radikalen, die Rechtsextremen. Das macht mir Sorge. Aus der historischen Betrachtung: Es ist keine kollektive Abwärtsbewegung einer Gesellschaft, die politischen Radikalismus erzeugt, sondern die Polarisierung.
MO: Stichwort Polarisierung, Spaltung: Welche Herausforderung bedeutet das für die Politik und welche Rolle spielen die Repräsentanten in der Politik in dieser Hinsicht?
Andreas Wirsching: Es ist eine extreme Herausforderung für Politiker, in dieser Pandemie die richtigen Rezepte zu finden. Es ist eine Situation, in der es eine richtige Lösung nicht gibt. Einerseits muss aus Sicht des Infektionsschutzes gehandelt werden. In der Ausgestaltung gibt es aber viele Möglichkeiten. Und andererseits wissen die Politiker auch, dass ihre Maßnahmen erhebliche Kollateralschäden verursachen. Das ist eine fatale Situation, die wir historisch betrachtet auch noch nie hatten. Was mich überdies beschäftigt, ist die politische Kommunikation. Der politische Diskurs ist mir zu homogen und moralisch aufgeladen. Ein wichtiger Punkt: Wir müssen von dem Verordnungsweg wegkommen. Die Krise ist zunächst die Stunde der Exekutive – das ist klar. Aber nach über einem halben Jahr geht es mit Verordnungen allein nicht mehr. Das ist ja auch im Zusammenhang mit dem letzten Infektionsschutzgesetz erkannt und diskutiert worden. Ein reines Verordnungsregime ist auf die Dauer gefährlich in seiner Wirkung, denn man kann sich daran gewöhnen und dies kann auch demokratische Gewohnheiten verschieben. Es muss dringend eine Re-Parlamentarisierung der ganzen Materie geben.
MO: Höre ich daraus, dass Sie die parlamentarische Demokratie als bedroht ansehen?
Andreas Wirsching: Zumindest muss man sehr wachsam sein. Es gilt für die Politik vor allem Glaubwürdigkeit zu bewahren und zurückzugewinnen. Die Tatsache, dass es diese massive Polarisierung und Unzufriedenheit bis hin zu politischer Gewalt gibt, hat natürlich Rückwirkungen auf die demokratische Parteienkultur. Koalitionen werden schwieriger zu bilden, und die ganze politische Willensbildung wird komplizierter. Schließlich hat sich unser Parteiensystem seit den 80er Jahren stark verändert. Dies alles erhöht die Verantwortung der demokratischen Parteien.
MO: Laut statista haben -Stand 2020- weniger als die Hälfte der Bevölkerung Vertrauen in die politischen Parteien.
Andreas Wirsching: Ja. Das ist nicht sonderlich beruhigend. Das tiefere Problem, das dahintersteht, ist die Repräsentation. Wir leben in einer strikt parlamentarischen Demokratie. Die hat sich bewährt, als bestes Mittel neue Konsense und Kompromisse zu finden. Aber da muss man auch wissen, was Repräsentation heißt: Es besteht das Missverständnis, dass viele denken „Ich wähle da jemanden und wenn der oder die nicht wirklich etwas für mich tun, dann sind sie nicht vertrauenswürdig.“ Das ist ein Missverständnis. Es geht ja um die Erzeugung eines höheren politischen Willens. Aber wir haben ein doppeltes Missverständnis. Nämlich wenn die Gewählten, die Repräsentanten, immer wieder meinen, sich rückversichern zu müssen in einer Legislaturperiode. Wenn man sich beständig rückversichern muss, wird man handlungsunfähig. Die Gewählten sollten viel selbstbewusster dafür einstehen, was sie für richtig halten. Vielleicht auch auf die Gefahr hin, wieder abgewählt zu werden. Da liegt ein Kernproblem, meines Erachtens.
MO: Welche Lösung kann es für dieses doppelte Missverständnis in der Anforderung der Bürger*innen einerseits und des Verhaltens der politisch Gewählten andererseits geben?
Andreas Wirsching: Die Lösung kann mit Sicherheit nicht in einer direkten Demokratie liegen. Denn eine direkte Demokratie würde neben der repräsentativen Demokratie, wie wir sie in Deutschland haben, eine zweite Quelle demokratischer Legitimation installieren. Wohin das führt, kann man in Großbritannien sehen. Dort besteht ein strikt repräsentatives System, es ist historisch gewachsen, und das Brexit Votum ist völlig quer zur britischen Verfassungstradition erzeugt worden. Es hat vorher nur ein wesentliches Referendum gegeben, beim Beitritt Großbritanniens zur EWG. In welche Selbstlähmung sich Großbritannien damit begeben hat, für viele Jahre, das kann man gut beobachten und es ist eine Katastrophe. Ich argumentiere gegen die Verquickung unterschiedlicher Formen der demokratischen Willensbildung. Sie können sich blockieren. Da ist auch die Weimarer Republik ein abschreckendes Beispiel. Präsidiale und parlamentarische Willensbildung blockierten sich damals gegenseitig und das war damals ein wesentlicher Grund für die Lähmung der Demokratie. Auf Länderebene oder kommunaler Ebene mag die direkte Demokratie vielleicht funktionieren, obwohl es auch da sehr kompliziert werden kann. Die Parteien müssten in einen ehrlicheren Diskurs mit sich selbst gehen, aber auch mit der Zivilgesellschaft.
MO: Um damit auch der Politikverdrossenheit entgegenzuwirken?
Andreas Wirsching: Ja! Es sollte Konsultationsorgane aus der Gesellschaft geben, ein bisschen wie die Bundesversammlung, die den Bundespräsidenten wählt. Aber es muss auch über das Kartell der Experten hinausgehen, die sowieso ständig in Kontakt stehen mit den Politkern und Amtsträgern. Die Basis muss angesprochen werden. Es gilt, neue Formen der partizipatorischen, der kommunikativ-partizipatorischen Demokratie zu finden. Das wurde auch erkannt, aber es ist sehr schwierig, das umzusetzen. Der normale Abgeordnete hat im Grunde immer zu wenig Zeit. Wenn man mit Parlamentariern spricht, sagen sie, sie gingen ja die ganze Zeit in die Wahlkreise und erklärten ihren Wählern ihre Politik. Tatsächlich ist es eine Herausforderung, Formate zu finden, wo Spitzenpolitiker jenseits von Wahlkampfzeiten wirklich mit dem Volk reden. „Townhall-Meetings“ könnten so etwas zum Beispiel sein, wo die Politiker stärker zum Anfassen werden, nicht nur medial vermittelt. Das ist meines Erachtens ein wichtiger Punkt, den man verfolgen sollte. Dass man die gefühlte Kluft zwischen gesellschaftlicher Realität und politischem Diskurs besser überbrücken kann, als das derzeit der Fall zu sein scheint.